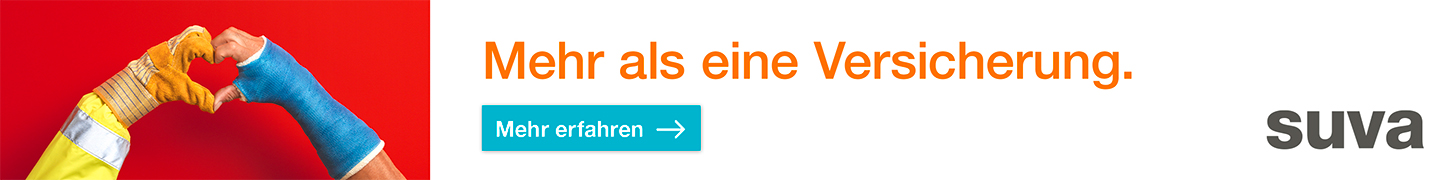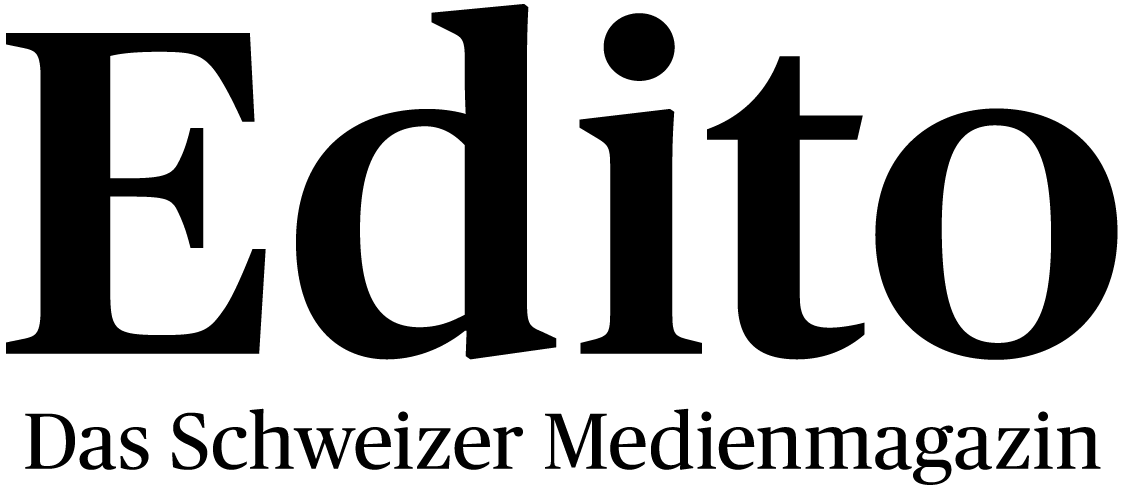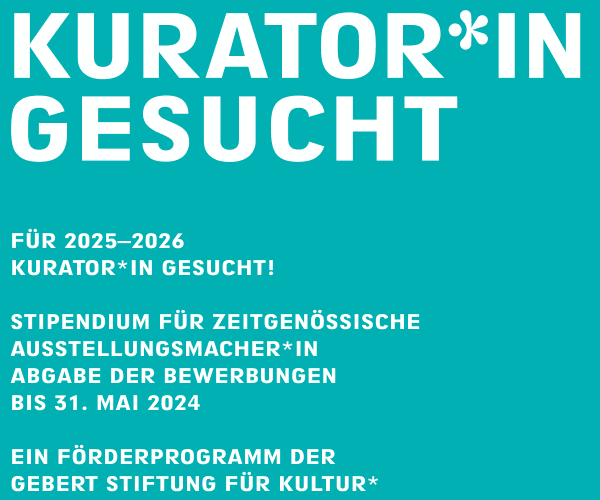Wir teilen so viel von unserem Privatleben auf den Social Media, wie wir wollen. Wir wähnen uns frei in unseren Entscheidungen. Doch was passiert, wenn der Arbeitsplatz in diesem Bereich Ansprüche erhebt?
VON JULIA KOHLI
Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einem kreativen Start-up und werden aufgefordert, ihre Ferienfotos doch bitte schön auch auf den firmeninternen Social-Media-Kanal raufzuladen. Alle anderen machen es schliesslich auch! Ist doch lustig! «Gehts noch?», war die häufigste Reaktion, die ich auf die Schilderung dieses Szenarios erhielt. Aber vielleicht kenne ich ja nur Eigenbrötler. Denn: Ja, offenbar geht das wirklich noch.
Von solchen Zuständen habe ich auf einer lauschigen Terrasse gehört, während des WM-Spiels Schweiz – Serbien, als ich mit Bekannten das Twitter-Gefecht zur Doppeladler-Geste mitverfolgte. Eine Kollegin, Angestellte eines Werbe-Jungunternehmens, seufzte unüberhörbar. «Überall dieses blöde Social Media! Eine einzige Tyrannei!» Musst ja nicht mitmachen, meinte eine weise Stimme mit Bratwurst im Mund. «Doch. Ich werde von Arbeitskollegen aufgefordert, meine Ferienfotos auf unserer Whatsapp-Gruppe zu posten.» Mit dieser kleinen Anekdote war der Doppeladler vergessen. Die Smartphones wurden zur Seite gelegt und eine wilde Diskussion über sonstige Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz brach aus.
«Man ist schliesslich Teil eines crazy Teams in crazy Zeiten! Wer will da schon Verräter sein.»
Der Tenor war klar: Community-Zwängerei – vor allem passiv aggressive Invasionen in die Privatsphäre – sei kontraproduktiv. Die eigenen Ferienfotos auch noch für die Arbeit kuratieren? Eine Zumutung! In dieser Whatsapp-Ferienfoto-Geschichte, so banal sie auch klingen mag, steckt also etwas Toxisches, sonst würde deren Erwähnung niemanden derart auf die Palme bringen.
Da die sozialen Medien nicht von sich aus böse sind, müssen wir annehmen, dass sie uns lediglich einen Spiegel vorhalten. Ich behaupte in diesem Fall, dass Firmen und Abteilungen, die ihre Mitarbeiter auf diese Weise zusammenschweissen wollen, ganz wichtige Tatsachen verdrängen: Zum Beispiel, dass ein Gefühl von Zusammengehörigkeit nicht erzwungen werden kann. Noch schlimmer: Versucht man es auf diese Weise – mit dem Austausch von Nichtigkeiten –, riskiert man Mitarbeitende zu isolieren, die ihre Privatsphäre zu Recht schätzen. Der kürzlich verstorbene Einsamkeitsforscher John T. Cacioppo betonte sogar, dass es vor allem das ständige Teilen von Belanglosem sei, das den Menschen einsam mache.
Zudem drängt sich eine weitere Vermutung auf: Könnten manche Start-ups mit solchen spassigen Nebenaktionen kaschieren wollen, dass sie ihre Mitarbeitenden ausnutzen? Diese kommen oft frisch und hoch motiviert aus dem Studium und sind bereit, grosse Opfer zu bringen.
Viele benützen die sozialen Medien der Firma sowieso schon in der Freizeit, machen Überstunden bis zum Umfallen und sind oft auch in den Ferien erreichbar. «The glorification of busy» nennen das die Kritiker dieser bereits angestaubten Silicon-Valley-Mentalität. Wird in emporstrebenden Unternehmen neben «Zulagen» wie Töggelikasten und Galapagos-Kaffee auch ein künstlicher Team-Spirit heraufbeschworen, ist die Hürde für Mitarbeiter hoch, aufzubegehren. Man ist schliesslich Teil eines crazy Teams in crazy Zeiten! Wer will da schon ein Verräter sein.
Sterben die «Gehts noch»-Menschen, die sich an ihre Privatsphäre klammern, womöglich bald aus? Das seien sowieso egoistische Fortschrittsverhinderer, meint der Stanford-Wissenschaftler Michal Kosinski – ein «Republik»-Kommentar zeigte kürzlich seine obskuren Argumente auf.
Ich starte eine Mini-Umfrage und hake beim Chef eines IT-Start-ups und einem Werbetexter nach – Arbeitsbereiche, wo ich viele Überschreitungen dieser Art vermute. Ich bin jedoch überrascht. Beide fühlen keinen Druck, das Private in der Arbeit teilen zu müssen. Null Ferienfoto-Gruppenzwang. Was mich am meisten erstaunt: Der Chef der IT-Firma erzählt, dass seine Mitarbeiter jeden Monat ein halbstündiges Einzelgespräch mit ihm hätten, in welchem sie Kritik und Verbesserungsvorschläge anbringen könnten. Gerade dort, wo ich Schlimmstes vermutet hatte, werde ich also mit einer engagierten, respektvollen Unternehmenskultur überrascht. Wieso diese Methode nicht viral geht und überall geteilt wird? Vielleicht, weil sie Zeit und Kritikfähigkeit fordert.
Autorin:
Julia Kohli ist Studentin Kulturpublizistik, freie Journalistin und Produzentin NZZ.
Ihr Kommentar