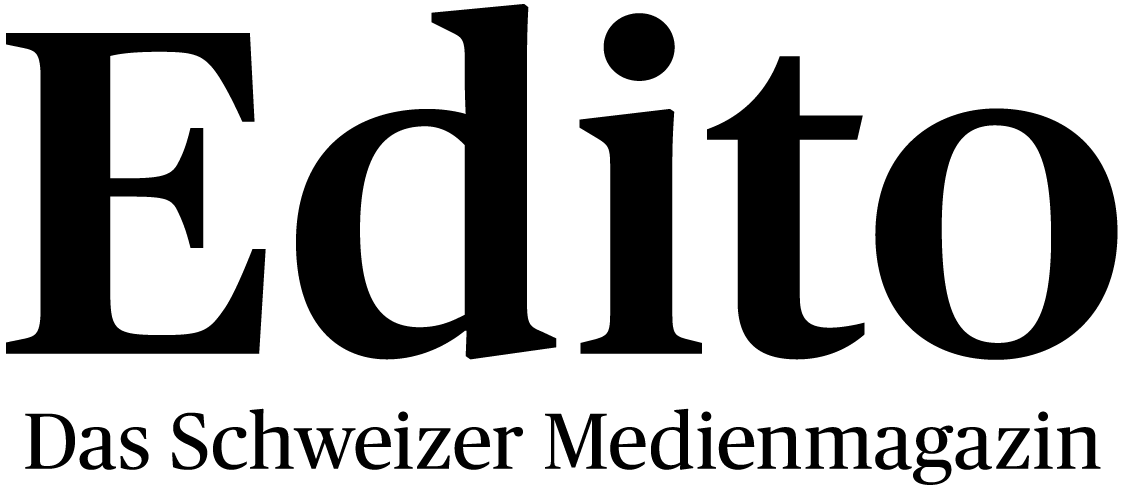Wir leben im Opferzeitalter – nie hatte das Opfer von Gewalt und Repression so viele Rechte. Gleichzeitig wünschen wir uns, es möge wieder verschwinden. Ein Diagnoseversuch.
Von Julia Kohli
Du Opfer!» ist heute ein beliebter Zuruf unter Jugendlichen – meistens ist damit kein feinfühliges Hilfsangebot gemeint. Konservative Medien schliessen sich dieser Rhetorik diskret an und kritisieren wahlweise den «Opferdiskurs» der Feministinnen oder die «Opferdebatte» von «Black Lives Matter». Anstatt die negative Konnotation des Wortes zu reflektieren, beugen sich auch linke Zeitungen dem Stigma, das dem «Opfer» anhaftet.
Zwei Autorinnen der taz schlugen letztes Jahr vor, statt «Opfer» «Erlebende» zu verwenden. «Erlebende» seien nämlich aktiv und somit ergäbe sich eine neue Perspektive. Würde die taz dann künftig von «Erlebenden des Syrienkriegs» oder von «Vergewaltigungserlebenden» berichten? Toll, verwandeln wir Gewalt in ein Erlebnis, Problem gelöst. Es scheint, als litten wir an einer Art Herrenmenschensyndrom. Wünschen wir uns das Opfer in die Verbannung?
Das Opfer erwacht im 20. Jahrhundert
Bis vor nicht allzu langer Zeit war es tatsächlich still, das Opfer. Bis ins 19. Jahrhundert lag es nämlich im Grab – meist kriegsbedingt. Die Historikerin Svenja Goltermann zeichnet in ihrem sinngemäss getitelten Werk «Opfer» nach, wie der Begriff den Weg ins Reich der Lebenden fand. Sie konzentriert sich dabei vor allem auf die Weltkriege. In dieser Zeitspanne, so stellt sie fest, wurden allmählich auch Veteranen und Hinterbliebene als «Opfer» bezeichnet. Dies hängt laut Goltermann eng mit einem Novum des 20. Jahrhunderts zusammen: den immensen staatlichen Sozialleistungen für Kriegsbetroffene. Der Staat musste Personen registrieren und einschätzen, wer hierzu Anspruch hatte. Medizin und Statistik erfuhren dadurch einen enormen Entwicklungsschub. Die Wahrnehmung von «Opfern» und deren symbolische Anerkennung waren also eng mit der Produktion von Wissen verbunden.
Doch das war nicht alles: Gleichzeitig mit dem statistischen Erfassen der Kriegsversehrten verbreitete sich eine «neue emotionale Ökonomie», wie es der Historiker und Kulturwissenschaftler Thomas Laqueur beschreibt. Tagebücher und Aufzeichnungen von Kriegsleid wurden zur kulturellen Praxis. Das Opfer wurde nicht nur zum aktiven Bittsteller mit Rechten, sondern auch zum Erzähler. Parallel begannen sich Wissenschaftler näher mit der Rolle des Opfers in der Gesellschaft zu befassen: Die Viktimologie entstand.
Die Opferforschung, lange als modischer Mumpitz belächelt, hat ihre Vorläufer in der Zwischenkriegszeit. In dieser Phase kam es zu problematischen Kategorisierungen, zum Beispiel, dass Frauen und Juden «geborene Opfer» seien – und damit auch teils mitverantwortlich für Verbrechen, die an ihnen begangen wurden. Zwar versuchten Viktimologen, nach dem Zweiten Weltkrieg besser zu differenzieren, die Wissenschaft beschränkte sich aber zunächst auf die Kriminalitätsprävention. In den 1980er Jahren erweiterte sich der Diskurs jedoch: Mit seinem Werk «The Politics of Victimization» rief der amerikanische Politologe Robert Elias dazu auf, die Viktimologie mit Menschenrechten zu vereinen. «Opfer» sollten neu auch Menschen sein, die staatliche Repression und Diskriminierung erleiden, er appellierte an eine «kollektive Verantwortung». Das Aufkommen des «Trauma»-Begriffs fällt auch in diese Zeit. Die psychischen Folgeerscheinungen von Krieg, aber auch von sexueller Gewalt, wurden neu betrachtet. Das Ende des 20. Jahrhunderts war also geprägt von einer Ausweitung des Opferbegriffs. Vielerorts wurden spezifischere Therapieformen angeboten, der Opferschutz gesetzlich geregelt – ein neuer Umgang mit Opfern entstand. Eine Entwicklung, welche der Allgemeinheit zugutekam, möchte man meinen.
Aufmerksamkeit zieht Kritiker an
Die Fokussierung auf das Opfer löste aber in den letzten Jahren auch ein grosses Augenrollen aus. Berechtigt, denn Gesetze können missbraucht werden und der Opferstatus kann dem Betroffenen eine unanfechtbare moralische Macht verleihen – das Opfer kann zum Täter werden. In seinem Werk «Die Opferfalle» beschreibt etwa der italienische Literaturwissenschaftler Daniele Giglioli, wie das Opfer «der Held unserer Zeit» geworden sei und «Opferstolz» zu einer fragwürdigen Strategie. Er prangert zudem den «opportunistischen Viktimismus» an, dessen sich Länder und Politiker bedienen. «Von den wirklichen zu den imaginären Opfern ist es ein langer und beschwerlicher Weg» erklärt Giglioli.
Das fordernde Opfer nervt, es ist mühsam und kompliziert, es rüttelt an Werten.
Genau hier scheitert Gigliolis Kritik aber, denn er liefert keine griffige Definition dieser «wirklichen» Opfer. Stattdessen verirrt er sich in stumpfen Verallgemeinerungen und schimpft über die angebliche Glorifizierung von Drogenabhängigen, leidenden Schriftstellern und Holocaust-Gedenkfeiern. Das Jammern und die Geschichtsversessenheit um ihn herum, so scheint es, erzürnen ihn dermassen, dass seine Kritik in einem irrationalen Strudel mündet. Wer seinen Essay liest, wartet vergeblich auf stringente Analysen von Politiker-Reden oder Parteiprogrammen. Es bleibt einzig ein futuristisch kaltes Grundrauschen. Eine Polemik, die zur bereits existierenden Stigmatisierung aller Opfer beiträgt, da sie nicht differenziert.
Die Grundmotive der Opfer-Skepsis sind klar: Das fordernde Opfer nervt, es ist mühsam und kompliziert, es rüttelt an Werten, die nicht von jedem angezweifelt werden. Jedes Opfer hat zudem eine eigene komplexe Geschichte, die zu verstehen Zeit, Empathie und Geduld erfordert. Manche von ihnen verhalten sich nicht so, wie man sich ein Opfer vorstellt. Sie lachen vielleicht zu viel oder führen ein moralisch fragwürdiges Leben.
In den Medien lesen und hören wir am liebsten diejenigen Geschichten, die mit der Ansage «Ich bin kein Opfer» beginnen. So muss es sein, denken wir. Dieser Mensch hat ein schlimmes Erlebnis in Stärke umgewandelt. Der langwierige Prozess bis dorthin kann aber von den Medien oft nicht mitgezeigt werden, und genau so wenig wird verdeutlicht, dass es die Mehrheit nicht schafft, zu reden. Wir fühlen uns alle wahnsinnig mündig und aufgeklärt. Doch sind wir das wirklich? Lauert in uns nicht noch ein Rest Gotteszornglauben, ein Rest Sozialdarwinismus? Täuschen wir uns nicht mit Selbsthilfe-Mantras über unsere Hilflosigkeit auf der Erde hinweg? Nach vorne schauen! Resilienz erlernen! Keine Frage, dies mögen wichtige Techniken für Lebenskrisen sein. Gefährlich wird es aber, wenn Opfersein als Unmöglichkeit angesehen wird. Denn damit verschwinden auch die Täter.
Darüber schreiben
Ein Gewinn wären mehr präzise Analysen, die gefährliche, demokratiefeindliche Opferinszenierungen entlarven – dort, wo aufgrund eines angeblichen Opferstatus Menschenrechte gestutzt werden und Pressefreiheit eingeschränkt. So geschehen in Polen, wo das «Holocaust-Gesetz» kritische Stimmen verbieten wollte, die am Opfernarrativ der Polen im Zweiten Weltkrieg kratzten. Schwach ist es, wenn man politische Bewegungen, die sich demokratischer Werkzeuge bedienen, generell lächerlich macht, indem man den Hammer «Opferwettbewerb» über ihnen fallen lässt. Ein Reisst-euch-doch-mal-zusammen-Kommentar ist schnell geschrieben, unreflektierte Opfersolidarität nützt dem Leser aber genau so wenig. Interessanter wäre eine Berichterstattung, die Widersprüche erträgt, keine «feel good story» aus dem Leid drehen will und respektvoll mit den vielen verschiedenen Erzählungen umgeht.
16 Kommentare
Ihr Kommentar